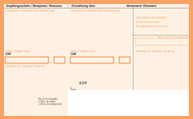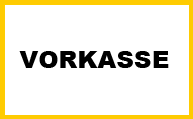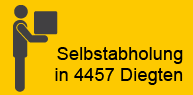Batterie-ABC
Abschlammung
AGM Batterie
Die AGM-Batterie punktet mit hoher Leistung und Ausdauer. Bei der AGM binden als Separatoren speziell absorbierende Glasfasermatten den Elektrolyt ein, was ein Auslaufen von Batteriesäure unmöglich macht. Die Platten von AGM-Batterien werden unter einer definierten Kompression eingebaut. So wird sichergestellt, dass eine optimale Verbindung zwischen Säure und Platten über die gesamte Lebensdauer der Batterie gewährleistet ist. Darüber hinaus verhindert die Kompression den Verlust der aktiven Masse und macht die Batterie somit besonders robust für anspruchsvolle Anwendungen.
Akkumulator
Aktive Masse
Träger der elektrischen Energie in Form energiereicher chemischer Stoffe. Die aktive Masse ist auf Bleigitter aufgetragen. Die chemische Zusammensetzung ändert sich jeweils bei Ladung und Entladung.
Batterie
Mehrere in Serie hintereinander geschaltete galvanische Elemente. Die 6-Volt-Batterie besteht aus 3, die 12-Volt-Batterie aus 6 Elementen.
Betriebsweise
Art des praktischen Einsatzes. Man unterscheidet zwischen Ladebetrieb (Notstrombatterie) und Zyklenbetrieb (Antriebsbatterie).
Destilliertes Wasser
Ausdruck für chemisch reines Wasser. Hergestellt durch Destillation und Ionenaustausch.
DIN
Abkürzung für: DEUTSCHE INDUSTRIE-NORMEN
EFB Batterie
Die EFB-Batterie ist eine leistungsgesteigerte Version der konventionellen Starterbatterie.
Dank verbesserten Gussplatten mit einem Polyester-Fleece-Netztes auf die PAM-Oberfläche, kann diese besonders effektiv genutzt werden. Das führt auch dazu, dass der Innenwiederstand der Batterie während der Batterie-Lebensdauer langsamer ansteigt, als es bei einer konventionellen Batterie der Fall wäre. Die EFB-Batterie findet breite Anwendung in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Systemen der Einstiegsklasse, in der Regel ohne Bremsenergie-Rückgewinnung.
Elektrische Energie
Mass für gespeicherte Arbeit, die eine Stromquelle abgeben kann, in Wattstunden (Wh) ausgedrückt. Sie wird berechnet als Produkt von Spannung, Strom und Zeit. Ein Bleiakkumulator von 12V und 60 Ah enthält eine Energie von 12x60 = 720 Wh. 1 Kilowattstunde (kWh) = 1000 Wh.
Elektroden
In einen Elektrolyten getauchte Platte verschiedener Polarität. Bei Bleiakkumulatoren enthalten die positiven Elektroden Bleioxyd und die negativen Elektroden pröses Blei.
Elektrolyt
Ionenleitfähige Flüssigkeit für galvanische Elemente. Bei Bleiakkumulatoren besteht der Elektrolyt aus verdünnter Schwefelsäure. (H2 SO4)
Elektromotorische Kraft (EMK)
Ruhespannung eines galvanischen Elements. Das EMK beträgt bei Bleiakkumulatoren 2.05 V pro Element.
EN
Europäische Norm
Entladespannung
Spannung, die beim Entladen von Batterien mit konstantem Strom gemessen werden.
Entladesstrom
Stromstärke, mit der eine Batterie entladen wird. Für die Kapazitätsprobe beträgt der Strom 1/20 der 20stündigen Kapazität in Ampère (A) ausgedrückt. Der Kaltstartstrom in Ampère beträgt das 3 bis 5fache der Kapazität in Ah.
Galvanisches Element (Sekundärelement)
Elektrochemische Stromquelle, die unmittelbar elektrischen Strom abgeben kann.
GEL-Batterien
Durch ihre Technologie mit festgelegtem Gel-Elektrolyt ist die Batterie absolut wartungsfrei und lageunabhängig.
Heavy Duty
Starterbatterie, speziell für den Einsatz in Lastwagen, Traktoren und Baumaschinen. Die Sonder-Bauweise erfüllt erhöhte Anforderungen bezüglich Rüttelfestigkeit und Zyklenbetrieb.
Hartblei
Bleilegierung mit einem Zusatz von Antimon.
Innerer Widerstand
Elektrischer Widerstand von galvanischen Elementen in Ohm (Ω) ausgedrückt.
Ionen
Träger elektrischer Ladung
Kaltstartstrom
Stromstärke, mit der eine auf – 18° C abgekühlte Batterie über eine bestimmte Zeitdauer geprüft wird. Dabei darf die vorgeschriebene Batteriespannung nicht unterschritten werden. Der Kaltstartstrom ist abhängig sowohl von der Batteriekonstruktion als auch von der Kapazität.
Kapazität
Strom-Fassungsvermögen eines Akkumulators in Ampèrestunden (Ah) gemessen. Die Kapazität eines Akkumulators wird bestimmt durch Entladung mit konstantem Strom während einer bestimmten Zeit. Bei Stromentnahme von z.B. 3A (Ampère) während 20 Stunden, beträgt die 20stündige Kapazität 60 Ah.
Knallgas
Explosives Gemisch aus Wasserstoff- und Sauerstoffgas. Knallgas entsteht beim Aufladen von Akkumulator gegen Ende der Ladung.
Kurzschluss
Direkte Verbindung zwischen den beiden Batterie-Polaritäten.
Ladeanlage
Anlage zur Erzeugung von Gleichstrom für Ladung von Akkumulatoren.
Ladespannung
Die Ladespannung ist abhängig vom Ladestrom und wird beim Laden des Akkumulators gemessen.
Ladestrom
Stromstärke, mit der eine Batterie ausserhalb des Fahrzeuges geladen wird. Der übliche Ladestrom beträgt ca. 1/20 der in Ah angegebener Kapazität im Ampère. Für eine Batterie mit 60 Ah beträgt der normale Ladestrom ca. 3 A.
Masseträger
Elektrisch leitende Träger für die aktive Masse, der die Zuleitung und Ableitung des Stromes übernimmt. Die Masseträger bei Akkumulatoren bestehen vorwiegend aus Hartbleigitter.
Monodeckelbatterie
Im Gegensatz zu Einzelement-Deckel werden sämtliche Zellen mit einem einzigen Deckel verschlossen. Kasten und Deckel ist verschweisst. Ein Reparatur-Austausch von einzelnen Zellen ist bei dieser Ausführung nicht mehr möglich.
Parallelschaltung
Je nach Kapazitätsbedarf können mehrere Elemente zusammengeschaltet werden. Dabei werden sowohl die positiven Anschlüsse als auch die negativen Anschlüsse miteinander verbunden.
Plattendeformation
Zerstörung der positiven Masseträger durch unfachgerechten Einsatz. Frühzeitige Plattendeformation entsteht oft durch regelmässige über- oder Tiefentladung der Batterie.
Polypropylen
Schlagfester, säure- und benzinbeständiger Kunststoff. Temperaturbeständig bis mindestens 100 °C. Wird unter anderem verwendet für Herstellung von Akkumulatorengehäuse.
Regler
Gerät zur Steuerung des Ladestromes. Der Regler ist ein wichtiger Bestandteil der Ladeanlage in Motorfahrzeugen.
Schwebeladung
Um die Selbstendladung eines Akkumulators auszugleichen, fliesst dauernd ein Ladestrom von ca. 1 mA pro Ah Batteriekapazität. Die Schwebeladung kommt vorwiegend bei Notstromanlagen zur Anwendung.
Schwefelsäure
Stark ätzende Flüssigkeit aus Sauerstoff, Schwefel und Wasserstoff. Für den Einsatz als Elektrolyt in Bleiakkumulatoren wird die Schwefelsäure zu einer ca. 38%igen Lösung mit Wasser verdünnt. Säuredichte = 1.28 Kg/l = 32° Bé
Selbstentdladung
Ladungsverlust des gefüllten, jedoch nicht im Einsatz stehenden Akkumulators. Galvanische Elemente entladen sich selbst. Es ist deshalb wichtig, dass aktivierte, nicht in Betrieb stehende Batterien regelmässig nachgeladen werden. Die Selbstentladung beträgt je nach Batterietyp ca. 0.2 % pro Tag.
Separator
Ionendurchlässige Membran zur Trennung der positiven und negativen Platten.
Serieschaltung
Hintereinaderschaltung mehrerer Elemente zum Zwecke der Spannungserhöhung. Der positive Pol wird jeweils mit dem nächsten negativen bzw. der negative mit dem nächsten positiven Anschluss verbunden. Die Anzahl Elemente ergeben nachher die gewünschte Spannung.
Spannung
Mass für den „Elektronendruck“, Angabe in Volt (V).
Spezifisches Gewicht
Gewichtsvergleich einer Flüssigkeit mit Wasser. Die Schwefelsäure für Akkumulatoren kann mit dem Säuremesser geprüft werden. Das Spezifische Gewicht der Säure eines vollgeladenen Akkumulators beträgt 1.28 kg/l oder 32° Beaumé.
Startspannung
Entladespannung bei Beginn der Batterieentladung beim Starten eines Motors. Die Startspannung ist das Mass für die Fähigkeit einer Autobatterie, den Motor zu starten.
Start-Stopp

Die Idee hinter dem Start-Stopp-System ist einfach: Wird der Motor des Fahrzeugs bei kurzen Wartezeiten, zum Beispiel an einer Verkehrsampel ausgestellt, sinken der Kraftstoff-Verbrauch und die Emissionen. So hilft die Start-Stopp-Automatik dabei, Treibstoff zu sparen und das Klima zu schützen. Mit der Technologie lassen sich die CO2-Emissionen um 3 – 8% reduzieren. Der Nutzen für die Umwelt und die verbesserte Wirtschaftlichkeit gewährleisten eine rasche Verbreitung der Start-Stopp-Automatik über alle Fahrzeugklassen hinweg.
Stromstärke
Mass für "Elektromenge", Angabe in Ampère (A).
Sulfatierung
Bezeichnung für unlösliches Bleisulfat, das sich an den Platten ansetzt und die Leistung sukzessiv reduziert. Hauptursache der Sulfatierung ist ungenügende Ladung der Batterie.
Überladung
Fortgesetzte Ladung einer bereits vollgeladenen Batterie mit dem üblichen Ladestrom. überladung führt bei Bleiakkumulatoren zu Erwärmung, Gasentwicklung und erhöhtem Wasserverbrauch und schlussendlich zur Plattendeformation.
Wartungsfreie Batterie
Starterbatterie, die unter bestimmten Voraussetzungen keinen Unterhalt erfordert.
Zyklenbetrieb
Vorwiegend bei Antriebsbatterien in Anwendung. Die Batterie wird regelmässig ent- bzw. wieder aufgeladen. Der Zyklenbetrieb bedingt eine optimale Wartung der Batterie. Zur Verhütung von frühzeitiger Abschlammung ist eine zu starke Entladung zu vermeiden.